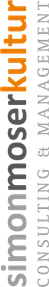- Start
- Projekte
- Musik für ganz Wittgenstein
- Wittgenstein
- Staufen
- Rotary for Artists
- Leistung macht Schule
- smk
- Bundesverband der Freien Musikschulen
- MDR KLASSIK
- Chronik
- Rundfunkchor
- Musik erleben.Verstehen.
- Musik & Kommunikation
- 88 KEYS together
- Charity
- Internationales Medtner Festival
- Kommunale Projekte
- Luther. Der Verkünder.
- Musik erleben. Verstehen. Oberkirch
- kumadoo
- Artists
- Referenzen
- Blog
- Contact
Gemeinsam Musik machen, das schafft Lebensqualität
Musik weckt unsere Emotionen unabhängig von Herkunft, Sprache oder Bildung. Dass Musik uns in Seele und Geist gesunden lässt, ist inzwischen erwiesen. Das "Kultur auf Rezept", vom Arzt verschrieben ein Schritt in die richtige Richtung ist, zeigen erste Best-Practice-Beispiele, etwa an der Bremer VHS oder der Charité in Berlin. Community Music kann einen Beitrag zur mentalen Gesundheit leisten, bietet aber auch ein gewisses Konfliktpotential im Vergleich zur Musiktherapie. Was unterscheidet beide? Wo sollte eine Grenze gezogen werden? Fragen, die in Deutschland noch nicht eindeutig geklärt sind.
WHO und EU befürworten und fördern kulturelle Interventionen
Seit ca. dem Jahr 2000 hat sich die internationale Forschung intensiver dem Thema 'Musik & Gesundheit' gewidmet. Die WHO stuft Künste, wie z.B. Malen, Zeichnen, kreatives Schreiben, Singen, Musizieren oder Improvisationstheater, bei der Krankheitsbewältigung und -behandlung als gesundheitsförderlich ein. Kunstbasierte Interventionen auch außerhalb von Kliniken haben positive Effekte und zeigen ähnliche Evidenz wie therapeutische Interventionen an Kliniken.
In ganz ähnliche Richtung geht auch die EU-Initiative „Culture for Health“, der 309 Studien zu Grunde liegen, und die die Vorteile von Kunst und Kultur in die Gesundheits- und Sozialpolitik der EU integrieren möchte. Andere Länder wie England, Irland oder Norwegen sind da schon weiter als Deutschland, was sich in der Zusammenarbeit mit Kommunen und der zunehmenden Institutionalisierung zeigt.
Info's zum Vertiefen
Situation in Deutschland
In Deutschland fehlen noch entsprechende Strukturen, aber es gibt eine Reihe von Initiativen, die dabei unterstützen wollen, den politischen Wandel zu fördern, Wissen auszutauschen, Best Practice-Beispiele zu erfassen und kooperative Pilotprojekte zu starten. Sie sehen in kulturellen Aktivitäten vielfältige Chancen das körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern, die soziale Eingliederung zu fördern und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Community Music vs. Musiktherapie
Eine klare Position fehlt in Deutschland noch. Der Diskurs dazu hält seit über 10 Jahren an und sorgt für viele Missverständnisse. Das große Defizit ist: Musiktherapeuten wissen nicht von den Möglichkeiten der Community Music und umgekehrt.
Musiktherapeutische Arbeit verlangt als zwingende Voraussetzung ein Studium bzw. Fachausbildung. Sie ist institutionalisiert, arbeitet wertschätzend, nicht wertend und sie bietet in Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen einen “safe place“ für Patienten.
Wer macht eigentlich was?
Community Music wirkt außerhalb von Kliniken. „Community Musician“ ist kein geschützter Begriff. Ein Community Musician darf sich nicht Therapeut nennen, auch wenn er in eine ähnliche Richtung arbeitet. Ein Community Musician stellt keine Diagnose, hat es nicht mit Patienten, sondern mit Teilnehmern zu tun und hat auch keinen Heilauftrag, wie ihn der Therapeut erhält. Aus Gründen der Patientensicherheit ist daher ein Studium für Therapeuten zwingend.
Es gibt aber auch spezielle Situationen, wie z.B. in denen Kranke von Musikern, ohne einen therapeutischen Anspruch, begleitet werden, etwa bei Long-Covid-Betroffenen, die unter bestimmten Voraussetzungen z.B. von der geschult tiefen Atmung der Opernsängern oder Gesangspädagogen profitieren können.
Dennoch bleibt festzuhalten, der Community Musician arbeitet generell mit gesunden Menschen zusammen. Er arbeitet vor allem in Gruppen, daher sollte er sensibel und souverän mit Gruppenmechanismen und -dynamiken umgehen können. In der Gruppe entstehen immer wieder Grenzbereiche: Teilnehmende dominieren eine Gruppe, sie fliehen aus ihr, zeigen sich kommunikationslos oder sind unfähig ihre Emotionen zu beherrschen, was auch zu einer Überforderung des Community Muscians führen kann. Das kann einen anfänglich sicheren Raum auch zu einem unsicheren Raum machen.
Unsere psychische Gesundheit verschlechtert sich
Die Entwicklung betrifft alle Geschlechter, Bildungs- und Altersgruppen. Von psychischen Belastungen betroffen sind aber besonders Frauen, junge Erwachsene und die Generation 65 +. Das Robert-Koch-Institut hat in seinen Zahlen von 2023 festgestellt: Die Psyche von insgesamt 40,4 % der Erwachsenen ist beeinträchtigt ist, davon haben z.B. 7,9 % Angststörungen, 14,4 % sind depressiv oder eine von vier Frauen ist Angst belastet. Der Umgang mit Social Media fördert dies, so empfinden 21 %, der meist jüngeren Menschen, den Content der Social-Media-Kanäle als belastend. 40 % der Jugendlichen verwendet täglich vier Stunden Zeit auf diversen Plattformen und 32 % empfinden sich durch den Inhalt als von der Gesellschaft ausgegrenzt.
Die Inhalte der obigen Website basieren auf Konferenz-Mitschriften zu Volker Bernius Präsentation "Kultur und Gesundheit - ein neuer Blickwinkel für die Community Music?" Volker Bernius ist Redakteur der Fachzeitschrift "Musiktherapeztische Umschau - Forschung und Praxis der Musiktherapie"